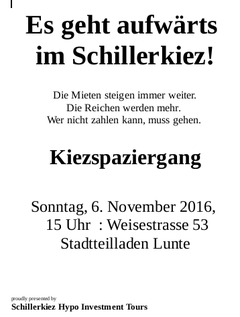Ein geschichtlicher Rückblick aus der eingestellten Zeitschrift „Scheinschlag“ vom April 2003 :
Eckkneipen gegen Aufwertung
Eckkneipen gegen Aufwertung
Die Schillerpromenade in Neukölln
Wer am frühen Abend durch die Neuköllner Oderstraße schlendert, kann einen sehr schönen Sonnenuntergang genießen. Durch die Nato-Draht-be-wehrte Absperrung des Flughafens Tempelhof kann man den Blick in die Ferne schweifen lassen und vor sich hin dösen – und sich von gelegentlich vorbeifliegenden Flugzeugen wieder wecken lassen. Wer sich setzen mag, sollte aber Campingstühle mitbringen, Straßencafés gibt es hier nicht. Das wird sich auch nicht ändern, denn die Häuser wurden in den zwanziger Jahren gebaut und haben keine Ladenräume. Damals achtete man eher darauf, daß alle Wohnungen Sonne abbekamen und einen Balkon hatten, was besonders im Block zwischen Leine- und Okerstraße auffällt, der 1925 nach Plänen des Bauhaus-Architekten Bruno Taut entstand.
Der Rest des Kiezes zwischen Hermannstraße und heutigem Flughafen Tempelhof entstand ab 1905. Damals war das Tempelhofer Feld noch ein Exerzierplatz, weshalb bei Westwind Sandstürme die Gegend heimsuchten. Das neue Viertel, mit der Schillerpromenade als Kern, sollte den miesen Ruf des damaligen Rixdorf aufpolieren helfen. Mit vergleichsweise breiten Straßen und viel Grün gedachte man, „bessere Leute“ in die proletarische Bastion zu locken. Das Konzept war mit dem Erstbezug bereits gescheitert. Statt des betuchten Bürgertums zogen in die Vorderhäuser neben sozial absteigenden Handwerkern, hauptsächlich Künstler ein, die in den Varietés in der Hermannstraße oder an der Hasenheide ihr Geld verdienten, während die Hinterhäuser von Arbeiterfamilien besiedelt wurden – mit einer Belegungsdichte von durchschnittlich vier Personen je Ein- bis Zwei-Raum-Wohnung.
Mindestens zwei Dinge blieben seitdem unverändert: Kaum jemand zieht freiwillig in diese Ecke, und viele, die hier trotzdem landen, verstehen das als vorübergehend, selbst dann, wenn sie schon zehn Jahre hier wohnen. Neukölln hat sogar bei vielen Einheimischen einen schlechten Leumund; besonders zugezogene Deutsche verachten die Neuköllner ohne sich selbst dazuzuzählen natürlich. Gemeint sind hauptsächlich die deutschstämmigen Eingeborenen, also diejenigen, die regelmäßig in den Eckkneipen abhängen sowie die türkischen Einwanderer und deren Nachfahren.
1999 haben die Neukölln-Verächter institutionelle Unterstützung bekommen. Seitdem treibt ein „Quartiersmanagement“ im Kiez sein Unwesen. Schon der Name verrät die Technokraten: Erklärtes Ziel ist es, das Viertel aufzuwerten. Dazu betreibt man im wesentlichen etwas Marketing, um den Standort Schillerpromenade in der weltweiten Konkurrenz der Stadtteile besser zu plazieren. Wieder einmal sollen „bessere Leute“ angelockt werden. Angesichts der Aussichtslosigkeit ihres Unterfangens täten einem die Quartiersmanager fast leid, ähnelten ihre Projekte nicht so sehr einer schwäbischen Kehrwoche. Immer wieder heben sie ihren Kampf für Ordnung und Sauberkeit hervor, so auch letzten Sommer, als sie zusammen mit Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie der Polizei regelmäßige Putzaktionen im Volkspark Hasenheide organisierten, „um die Dealer bei ihren Geschäften zu stören“.
In der Speisekarte des Café Lohffs in der Weisestraße findet sich eine klare Kampfansage an die Zecher in den Eckkneipen: Korn-Trinker werden hier ausdrücklich ausgeschlossen. Eine derartige Provokation wäre vor dreißig Jahren noch undenkbar gewesen. Als im September 1969 in der Kienitzer Straße 100 die APO-Kneipe Hipetuk eröffnete, überfielen einheimische Rocker die linken Missionare. Erst nachdem die Polizei erschien, verbrüderten sich die Kampfparteien, schlugen die bewaffnete Staatsmacht in die Flucht und begossen anschließend ihren Sieg gemeinsam in der neuen Schenke.
Die Eckkneipen, von denen es bis vor ein paar Jahren an fast jeder Ecke eine gab, waren von Beginn an prägend für die kulturelle Identität des Viertels. Entstanden sind sie nicht zuletzt wegen der beengten Wohnverhältnisse. Die Familienväter und die männlichen Schlafgänger flohen in die umliegenden Wirtshäuser, die als „verlängerte Wohnzimmer“ dienten. Diese Kneipen waren eine Mischung aus mittelständischer Handwerkerkneipe und dem vorher üblichen Stehausschank für Arbeiter. Bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten bildeten sie das Fundament der organisierten Arbeiterbewegung. Es gab sozialdemokratische, kommunistische und anarchistische Kneipen. Nach dem Verbot der Linksparteien wandelten die Nazis sie in Sturmlokale um, besetzten regelmäßig rote Destillen und bespitzelten sie gezielt. Angehörige des aktiven Widerstands mieden deshalb bald die Schenken. Damit war die politische Kneipenszene als Ort der Willensbildung zerschlagen und erholte sich davon auch nach dem Krieg nie wieder vollständig.
In den letzten Jahren haben viele der traditionellen Eckkneipen dicht gemacht, während andere unter neuem Namen weitergeführt werden. Sämtliche Gaststätten, die sich in ihrer Namensgebung auf den nahegelegenen Flughafen bezogen, kamen dessen Schließung zuvor. Die Kneipe Am Flughafen in der Okerstraße heißt jetzt Pinte II, Zur Landebahn in der Kienitzer Straße nennt sich Gladiator, und aus der Startbahn am Herrfurthplatz ist eine türkische Kneipe namens Kahve Kernek geworden. Das Kahve Kernek ist eine behutsame Weiterentwicklung der Neuköllner Eckkneipenkultur: Die alte Einrichtung wurde weitgehend übernommen, man hat lediglich ein paar Neonröhren angeschraubt, um sich besser sehen zu können. Ähnliches gilt auch für das Café Instanbul Spor in der Mahlower Straße, wo man sogar noch den alten Namen Happy Corner lesen kann. Seit kurzem gibt es in der Weisestraße auch eine polnische Kneipe namens Viva Polonia, die den alteingesessenen Kaschemmen nicht unähnlich ist. Es drängt sich der Eindruck auf, daß die nichtdeutschen Einwanderer mit den Ureinwohnern mehr gemein haben als die Deutschen, die aus anderen Stadtteilen einwandern.
Von einem Verschwinden der Neuköllner Eckkneipenkultur kann man also nicht unbedingt sprechen, eher von einer angemessenen Wandlung. Aber auch die alten Kneipen sind nicht alle verschwunden. Am 1. Mai beging das Handwerker-Stübchen in der Hermann-/ Ecke Allerstraße sein 27jähriges Jubiläum mit einer „riesen Grillfete“. Wer sich an diesem Tag vor der Schutt- und Aschelegung Kreuzbergs noch schnell stärken wollte, hat das Lokal wohl gemieden, denn dessen „Räume werden 24 Stunden am Tag videoüberwacht“.
Dirk Rudolph